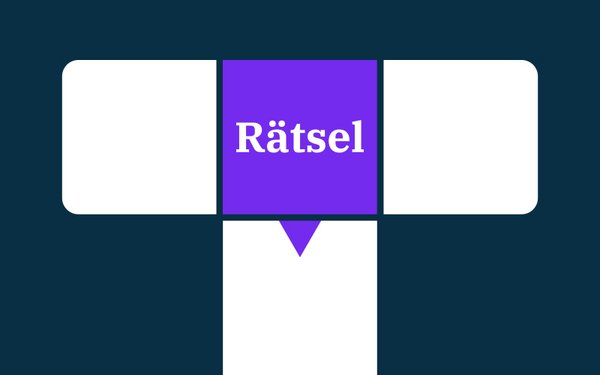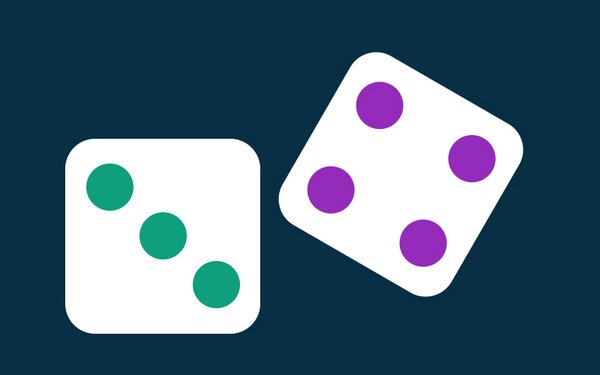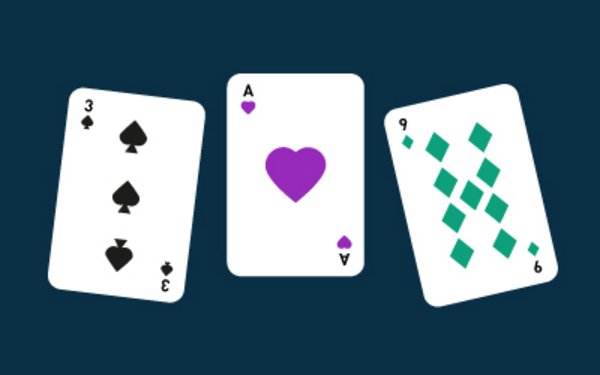AKZEPTANZ
Der Weg zur Akzeptanz: Wie Sie lernen, mit einer Diagnose zu leben
Die emotionalen Reaktionen darauf sind oft überwältigend. Schock, Wut, Trauer und Angst gehören zu den häufigsten Gefühlen, die Menschen in solchen Situationen erleben. Doch trotz dieser Herausforderungen kann das Leben auch nach einer Diagnose lebenswert und erfüllend sein.
Die erste Phase: Den Schock überwinden
Eine Diagnose kann das Leben radikal verändern. Der Moment, in dem die Nachricht übermittelt wird, hinterlässt oft eine tiefe emotionale Erschütterung. Viele Menschen beschreiben es als eine Art „Stillstand“, während die Welt um sie herum scheinbar normal weiterläuft. Der innere Monolog wird von Fragen dominiert: „Warum gerade ich?“, „Was habe ich falsch gemacht?“ oder „Wie soll es jetzt weitergehen?“. Diese Fragen sind Ausdruck einer Suche nach Sinn und Kontrolle, die durch die plötzliche Veränderung erschüttert wurde.
Die erste Phase nach einer Diagnose ist geprägt von intensiven und oft widersprüchlichen Gefühlen. Schock, Verwirrung und Unglaube stehen im Vordergrund, begleitet von einer tiefen Unsicherheit über die Zukunft. Es ist wichtig, zu verstehen, dass diese Reaktionen natürlich und menschlich sind. Sie zeigen, wie sehr das Leben durch die Diagnose durcheinandergebracht wurde.
Wichtig ist, die eigenen Gefühle und Reaktionen ernst zu nehmen und sich selbst Raum für diese Emotionen zu geben. Der Umgang mit dem ersten Schock lässt sich durch einige gezielte Ansätze erleichtern:
- Zeit geben: Es ist entscheidend, sich selbst die notwendige Zeit zuzugestehen, um die neue Situation zu verarbeiten. Der Druck, sofort alles verstehen oder akzeptieren zu müssen, ist kontraproduktiv.
- Emotionen zulassen: Oft besteht die Tendenz, diese Gefühle zu verdrängen oder als unangemessen zu empfinden. Doch das Unterdrücken von Emotionen kann langfristig mehr Schaden anrichten als das bewusste Zulassen.
- Offene Kommunikation: In Zeiten des Schocks neigen viele Menschen dazu, sich zurückzuziehen. Doch der Austausch mit anderen kann ein wertvolles Ventil für belastende Gedanken und Gefühle sein. Es hilft, nicht alles allein tragen zu müssen.
Zwischen Trauer und Wut: Emotionen verstehen
Nach der ersten Schockphase rücken andere Emotionen stärker in den Vordergrund. Viele Menschen verspüren Wut über das „Warum“ der Diagnose oder Trauer um das Leben, das sich möglicherweise grundlegend verändert. Diese Emotionen sind Teil eines Verarbeitungsprozesses und keine Zeichen von Schwäche.
Wut kann eine Reaktion auf das Gefühl der Ungerechtigkeit sein, die mit einer Diagnose oft einhergeht. Die Wut richtet sich möglicherweise gegen das eigene Schicksal, gegen äussere Umstände oder sogar gegen das Gesundheitssystem. Sie kann aber auch eine treibende Kraft sein, die dazu motiviert, aktiv zu werden und Lösungen zu suchen.
Trauer hingegen ist ein Ausdruck des Verlusts. Viele Menschen trauern um die Unbeschwertheit oder Gesundheit, die sie zuvor hatten. Diese Trauer kann belastend sein, aber sie ist ein notwendiger Teil der Anpassung an die neue Realität. Die Diagnose anzunehmen, erfordert Geduld mit sich selbst. Psychologische Begleitung kann helfen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, die eigenen Emotionen besser zu verstehen und mit ihnen umzugehen.
Das Positive nicht aus den Augen verlieren
In der Auseinandersetzung mit einer Diagnose ist es leicht, den Blick nur auf Verluste und Einschränkungen zu richten. Doch ein wesentlicher Schritt zur Akzeptanz ist es, den Fokus bewusst auch auf die positiven Aspekte des Lebens zu lenken und positiv zu denken. Das bedeutet nicht, die Herausforderungen zu leugnen, sondern inmitten dieser schwierigen Realität kleine Momente der Freude und Zuversicht zuzulassen.
Das bewusste Wahrnehmen kleiner Fortschritte – sei es eine gute Arztuntersuchung, das Meistern eines schwierigen Tages oder ein wertvoller Moment mit geliebten Menschen – trägt dazu bei, ein Gefühl der Hoffnung zu bewahren. Diese positiven Erlebnisse können als Anker dienen, um in belastenden Zeiten nicht den Mut zu verlieren. Aktivitäten, die Freude bereiten, wie ein Hobby, Zeit in der Natur oder der Austausch mit engen Freunden, stärken zudem das emotionale Wohlbefinden.
Der Weg zur Akzeptanz
Viele Menschen verwechseln Akzeptanz mit Resignation oder Aufgabe. Doch während Resignation mit einem Verlust an Hoffnung verbunden ist, bedeutet Akzeptanz, sich mit der neuen Realität auseinanderzusetzen und aktiv zu überlegen, wie ein erfülltes Leben trotz der Diagnose aussehen kann. Dieser Zustand ist kein linearer Prozess; er wird von Rückschlägen, Zweifeln und Fortschritten geprägt. Akzeptanz ist vielmehr eine Haltung, die sich entwickelt, wenn Menschen die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen, indem sie sich mit der neuen Realität arrangieren.
Ein zentraler Schritt auf dem Weg zur Akzeptanz ist das Verstehen der eigenen Diagnose. Unwissenheit und Unsicherheit verstärken oft Gefühle von Angst und Hilflosigkeit. Durch gezielte Informationen kann dieses Gefühl von Kontrollverlust abgemildert werden. Sich Wissen anzueignen, hilft nicht nur, die medizinischen Aspekte der Erkrankung zu begreifen, sondern auch, die eigenen Möglichkeiten zu erkennen.
Hierzu gehört, sich aktiv mit den Ursachen, Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Fachliteratur, vertrauenswürdige Websites oder Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten können hierbei wertvolle Informationsquellen sein. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen, beispielsweise in Selbsthilfegruppen, bietet Einblicke in Erfahrungen und Bewältigungsstrategien, die sich als hilfreich erweisen können.
Den Alltag an die Diagnose anpassen
Akzeptanz zeigt sich nicht nur in der inneren Haltung, sondern auch in der Bereitschaft, das Leben aktiv anzupassen. Hierzu gehören Massnahmen wie eine angepasste Ernährung, regelmässige körperliche Aktivität oder der bewusste Umgang mit Stress. Diese Veränderungen geben das Gefühl, aktiv zum eigenen Wohlbefinden beitragen zu können. Zum Beispiel kann eine veränderte Tagesstruktur helfen, Symptome besser zu managen und den Alltag überschaubarer zu gestalten.
Ein zentraler Aspekt praktischer Anpassungen ist es, die eigenen Bedürfnisse realistisch zu erkennen und die Erwartungen an sich selbst anzupassen. Dies bedeutet, sich nicht mit der Zeit vor der Diagnose zu vergleichen, sondern den Blick auf das zu richten, was unter den neuen Bedingungen möglich ist. Medizinische Alltagshelfer zum Erhalt oder der Verbesserung der Lebensqualität leisten hierbei einen wichtigen Beitrag. Je nach Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten gibt es speziell angepasste Apps. Dank des Digitale-Versorgung-Gesetz werden die Kosten für Apps, die von Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden können, von den Krankenkasse übernommen.
Die Möglichkeiten der Nutzung der Apps reicht von einfachem Medikamenten-Management über die Dokumentation von Symptomen oder die Überwachung verschiedener Vitalparameter wie Blutzucker, Sauerstoffsättigung oder Herzfrequenz bis zu Aufzeichnungen über die Behandlungsmethoden. In eigens dafür entwickelten Apps können Patienten mit Katheter beispielsweise festhalten, wann die letzte Drainage stattfand, und welche Flüssigkeitsmenge drainiert wurde. Dies hilft nicht nur, den Überblick über den eigenen Gesundheitsverlauf zu behalten, sondern gibt auch Sicherheit im Alltag und unterstützt den behandelnden Arzt dabei, die Therapie individuell und optimal anzupassen.
Unterstützung durch Freunde und Familie
Das Wichtigste, was Freunde und Familie tun können, ist zuzuhören. Oft geht es nicht darum, Lösungen oder Ratschläge anzubieten, sondern einfach präsent zu sein und den Raum für offene Gespräche zu schaffen. Menschen mit einer Diagnose benötigen manchmal die Möglichkeit, ihre Ängste und Sorgen auszusprechen, ohne bewertet oder unterbrochen zu werden.
Praktische Unterstützung kann ebenfalls eine enorme Entlastung sein. Das Übernehmen von Aufgaben wie Einkäufen, das Begleiten zu Arztterminen oder das Anbieten von Hilfe im Haushalt zeigt, dass die betroffene Person nicht allein ist. Gleichzeitig ist es wichtig, die Eigenständigkeit der betroffenen Person zu respektieren und Hilfe anzubieten, ohne bevormundend zu wirken.
Ein häufiges Problem in der Beziehung zwischen Betroffenen und ihrem Umfeld ist das Schweigen über die eigenen Bedürfnisse. Betroffene neigen oft dazu, ihre Herausforderungen herunterzuspielen, um andere nicht zu belasten. Doch Offenheit ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden und echte Unterstützung zu ermöglichen. Ebenso ist es wichtig, über persönliche Grenzen zu sprechen. Wenn die Diagnose zu Erschöpfung führt, sollte dies klar kommuniziert werden, um unrealistische Erwartungen seitens der Familie oder Freunde zu vermeiden.
Leben mit einer Diagnose, nicht trotz einer Diagnose
Das Leben mit einer Diagnose bedeutet nicht automatisch, dass Freude und persönliche Ziele aus dem Leben verschwinden müssen. Eine der effektivsten Möglichkeiten, das Gefühl von Kontrolle zurückzugewinnen, ist die Entwicklung fester Routinen. Regelmässige Abläufe, wie das Einhalten von Schlaf- und Essenszeiten oder das Integrieren von Bewegung in den Tagesablauf, schaffen Stabilität.
In der Auseinandersetzung mit einer Diagnose können vermeintlich kleine Momente des Glücks eine grosse Bedeutung bekommen. Ein Spaziergang in der Natur, Zeit mit geliebten Menschen oder das bewusste Geniessen einer Tasse Tee: Solche Momente fördern das emotionale Wohlbefinden und helfen, die Lebensqualität zu erhalten. Und vielleicht schaffen solche bewussten Momente des Glücks es sogar, dass Betroffene die Diagnose für eine kurze Zeit ausblenden.
Newsletter abonnieren und gewinnen! 
Melden Sie sich für unseren wöchentlichen Newsletter an und nehmen Sie automatisch an der nächsten Verlosung des Preisrätsels teil.