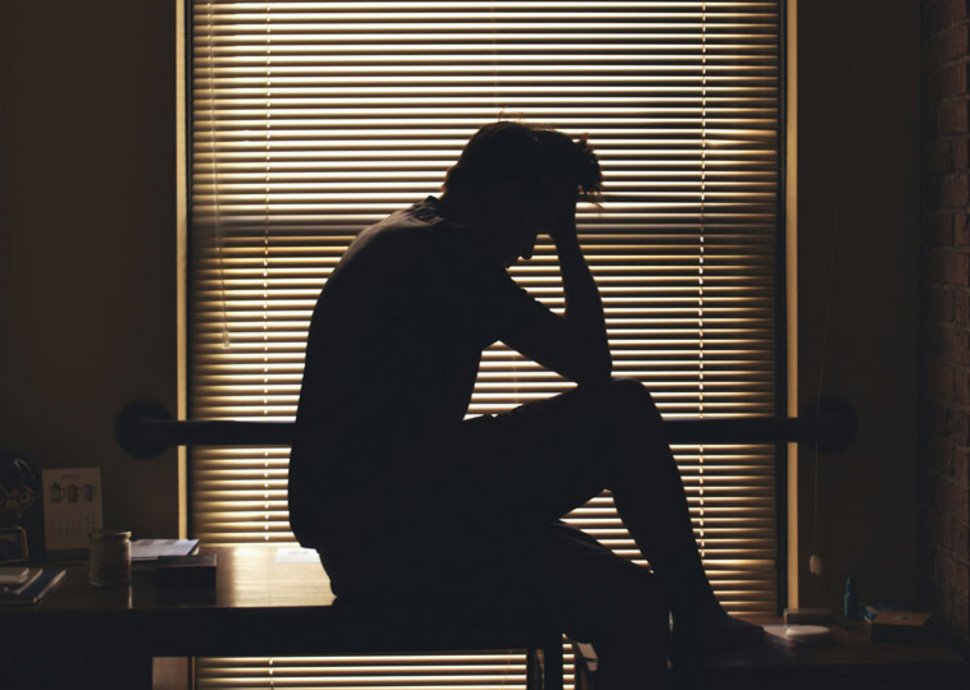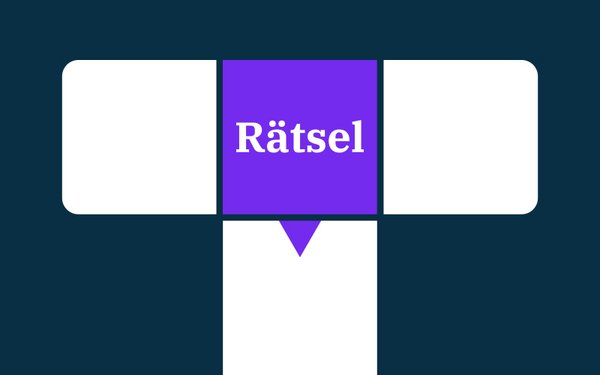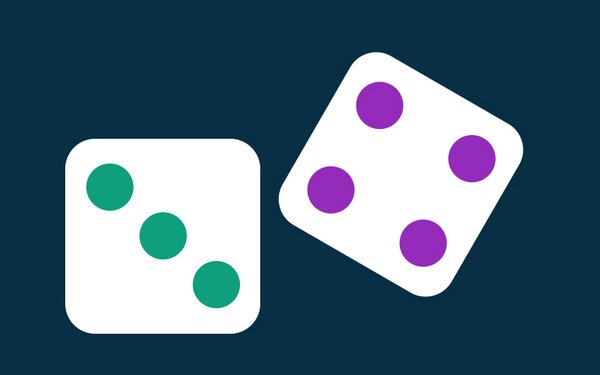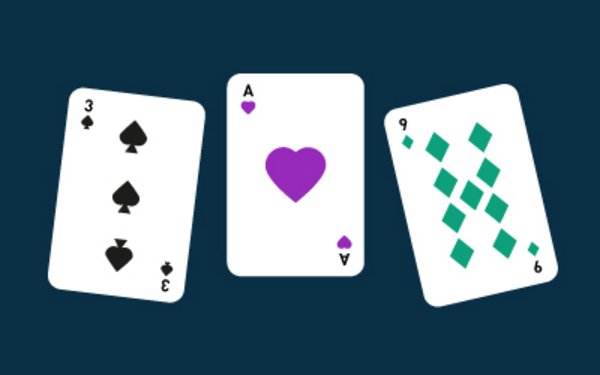DEPRESSION
Volkskrankheit Depressionen: Bin ich betroffen?
Dabei nimmt die Zahl der an einer Depression Erkrankten in Deutschland von Jahr zu Jahr zu, sodass Fachleute die Krankheit bereits als Volkskrankheit bezeichnen. Doch was genau ist eine Depression und wie zeigt sie sich? Hierüber will der folgende Artikel aufklären, ohne allerdings eine psychiatrische Diagnose ersetzen zu können.
Ist man an einer Depression erkrankt, sollte man diese Krankheit ernstnehmen und sich über Therapieoptionen informieren: Im Rahmen einer ärztlichen Behandlung können Antidepressiva wie Venlafaxin eingesetzt werden, die gut verträglich und individuell dosierbar sind. Auch Psychotherapie hilft vielen Betroffenen. Bei schweren Depressionen setzt man häufig auf die Kombination von medikamentöser und psychotherapeutischer Behandlung.
Was ist eine Depression?
Depression ist eine psychische Erkrankung aus dem Bereich der affektiven Störungen. Diagnostiziert wird sie anhand medizinischer Standards, in Deutschland nach den weltweit geltenden ICD-10-Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (ICD ist die Abkürzung für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems = Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme). Zu den Hauptsymptomen einer Depression zählen laut ICD-10 eine andauernde Niedergeschlagenheit/Traurigkeit in Verbindung mit Interessen- und Antriebsverlust sowie eine starke, nicht durch besondere Anstrengungen ausgelöste Erschöpfung. Hinzu kommen fast immer weitere psychische, körperliche und kognitive Symptome.
Es gibt wohl kaum Menschen, die nicht hin und wieder traurig sind. Solange diese Traurigkeit wieder vorübergeht, besteht keinerlei Anlass zur Sorge. So ist nach einem Todesfall auch eine Zeit des Trauerns völlig normal – selbst dann, wenn der seelische Schmerz für Aussenstehende dramatisch erscheint. Erst dann, wenn sich jemand nach einer solchen Phase überhaupt nicht mehr erholt, Kontakte vernachlässigt oder aber ohne erkennbaren Auslöser ständig niedergeschlagen und freudlos ist, sollte man an eine Depression denken. Eine klinische Depression ist eine ernsthafte Erkrankung und etwas grundlegend Anderes als Trauer oder eine nur vorübergehend gedrückte Stimmung.
Gut zu wissen: Leiden Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter an einer Depression, sprechen Laien oft von einer sogenannten Altersdepression. Dabei unterscheiden sich Depressionen im Alter nicht wesentlich von einer Depression in jüngeren Jahren und werden als ähnlich belastend im Alltag erlebt. Allerdings gibt es oftmals Fehldiagnosen, da bei vielen älteren Menschen bereits Erkrankungen mit ähnlichen körperlichen Symptomen bestehen und zudem insbesondere ältere Männer dazu neigen, psychische Probleme vor sich selbst und anderen „herunterzuspielen“. Manchmal wird eine Depression in dieser Lebensphase auch mit einer Demenz verwechselt – das geschieht vor allem dann, wenn die kognitive Symptomatik im Vordergrund steht. Ärztinnen und Ärzte sollten dies bei der Diagnose bedenken, während Patienten und Patientinnen nicht zögern sollten, psychische Beschwerden wie Trauer, Freud- und Hoffnungslosigkeit zu thematisieren.
Typische Symptome einer Depression
Depression ist eine Erkrankung, die nicht nur verschiedene Gesichter hat, sondern auch oft genug eine Maske trägt. Entsprechend können Erkrankte eine Vielzahl psychischer, physischer und kognitiver Symptome aufweisen, die im Verlauf der Depression durchaus variieren können. Insbesondere die körperlichen und kognitiven Symptome sind oft nicht eindeutig, sondern können auch bei anderen Erkrankungen auftreten. Aus diesem Grund ist es essenziell, dass Depressionen ärztlich diagnostiziert werden. Die folgenden Symptome gelten als typisch für eine Depression:
Psychische Symptome
Die psychischen Symptome sind wohl die bekanntesten: Niedergeschlagene, gedrückte Stimmung hat der Krankheit ihren Namen gegeben. Je nach Persönlichkeit äussert sich das Leitsymptom als anhaltende Traurigkeit bis hin zur Verzweiflung, als allgemeine Freudlosigkeit und/oder als Verlust von Antrieb und Interessen. Typisch für eine (schwere) Depression ist zudem die (subjektive) Überzeugung, dass sich der Zustand nicht wieder ändern wird, was zu einem Gefühl umfassender Hoffnungslosigkeit führt. Viele Patientinnen und Patienten berichten von Gefühlen innerer Leere, manche wirken allerdings eher rastlos, gereizt und sogar aggressiv, was eine korrekte Diagnose erschwert.
Körperliche Symptome
Die physischen Symptome einer Depression machen sich oft als erste bemerkbar, bevor die typischen Veränderungen der Stimmung auftreten. Schlafstörungen sind ein geradezu klassisches Warnsignal – zu ihnen gehören sowohl Schlaflosigkeit, Ein- und Durchschlafstörungen als auch ein exzessives Schlafbedürfnis. Fast immer kommt ein Gefühl permanenter Erschöpfung hinzu, das sich auch durch Ruhephasen kaum verbessert. Die körperliche Erschöpfung fördert zudem die depressive Antriebsminderung/Antriebslosigkeit. Von Appetitveränderungen ist nur ein Teil der Patientinnen und Patienten betroffen. Neben Appetitmangel können (seltener) auch Heisshunger und Gewichtszunahme auf eine Depression hinweisen.
Kognitive Symptome
Gerade bei älteren Menschen können die kognitiven Symptome von Depressionen dazu führen, dass die falsche Diagnose einer Demenz gestellt wird und die Betroffenen keine adäquate Therapie erhalten. Viele Depressive leiden an Konzentrationsstörungen und Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung. Der soziale Rückzug, der typisch für Depressionen ist, kann zu mangelnder geistiger Stimulation und damit zu einer Verstärkung der kognitiven Symptomatik beitragen: ein Teufelskreis, der sich jedoch mit geeigneter Medikation unterbinden lässt.
Ursachen und Risikofaktoren
Trotz unzähliger wissenschaftlicher Studien ist (noch) nicht geklärt, warum Menschen eine Depression entwickeln. Forschende gehen davon aus, dass mehrere Faktoren zusammenspielen, insbesondere biologische und psychosoziale. Als sicher gilt, dass es eine genetisch bedingte Disposition gibt, die das Auftreten einer Depression wahrscheinlicher macht.
Bildgebende Verfahren konnten nachweisen, dass sich bei Depressiven die Hirnaktivität im für die Emotions- und Stressregulierung limbischen System veränderte. Ausserdem geht man davon aus, dass bei an einer Depression leidenden Menschen die Balance bestimmter Botenstoffe gestört ist. Ob dieses Neurotransmitter-Ungleichgewicht nun die Ursache oder eine Folge der Depression ist, bleibt Diskussionsgegenstand – doch zumindest lässt sich an diesem Punkt therapeutisch ansetzen: Antidepressiva beeinflussen die Konzentration von Botenstoffen wie Serotonin, Noradrenalin und Dopamin und können dadurch antriebsteigernd und stimmungsaufhellend wirken.
Neben diesen biologischen Risikofaktoren können vor allem psychosoziale Belastungen dazu führen, dass jemand an einer Depression erkrankt. Hierzu zählt etwa der Verlust eines geliebten Menschen, sei es durch Trennung, sei es durch Tod. Mit einem besonders hohen Risiko für Depressionen wie auch für andere psychische Erkrankungen sind in der Kindheit erlittene Traumata verbunden. Im Erwachsenenleben erhöhen sowohl länger andauernde Arbeitslosigkeit als auch chronischer Stress am Arbeitsplatz das Risiko für eine Depression (die mitunter nur schwer von einem Burnout abgegrenzt werden kann).
Schwere Krankheiten wie eine Krebserkrankung, chronische Schmerzen oder das chronische Erschöpfungssyndrom führen zu physischer und psychischer Be- und Überlastung, die in eine Depression münden kann. Vor allem bei chronisch Kranken, aber auch bei körperlich Gesunden stellen Einsamkeit und anhaltende soziale Isolation einen grossen Risikofaktor dar, an einer Depression zu erkranken.
Häufig kommen mehrere Faktoren zusammen: Man hat die Partnerin verloren, ist körperlich eingeschränkt und zieht sich aus dem sozialen Leben zurück – und dann entwickelt sich geradezu schleichend aus der zunächst ganz normalen und gesunden Trauer eine Depression. Wer so etwas bei sich oder anderen beobachtet, sollte nicht zögern, fachärztlichen Rat einzuholen.
Behandlungsmöglichkeiten
In vielen Fällen stellt bereits der Hausarzt oder die Hausärztin die Diagnose Depression. Anschliessend sollte eine Überweisung an einen Facharzt oder eine Fachärztin für Psychiatrie erfolgen.
Depressionen werden medikamentös mit Antidepressiva oder mit einer Psychotherapie oder mit einer Kombination aus beidem behandelt. Anerkannte psychotherapeutische Verfahren sind etwa die kognitive Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse und die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie.
Vor allem bei mittelschweren und schweren Depressionen raten Fachleute dazu, eine medikamentöse Therapie in den Behandlungsplan miteinzubeziehen und nicht ausschliesslich auf Gesprächs- oder Verhaltenstherapien zu setzen. Moderne Antidepressiva wie Venlafaxin sind sicher und gut verträglich. Aufgrund der mittlerweile grossen Bandbreite an unterschiedlichen Wirkstoffen können Ärztinnen und Ärzte die Therapie optimal an die Bedürfnisse der Erkrankten anpassen und dabei auch berücksichtigen, welche weiteren Krankheiten vorliegen und welche anderen Medikamente eingenommen werden müssen.
Antidepressiva haben eine stimmungsaufhellende, meist auch antriebsteigernde Wirkung und können so mehrere Symptome von Depressionen zugleich bekämpfen. Bis eine Linderung der Symptomatik eintritt, können allerdings einige Wochen vergehen – umso wichtiger ist eine konsequente Einnahme im Rahmen eines fachärztlich erstellten Behandlungsplans.
Um ihre stimmungsaufhellende Wirkung zu erzielen, beeinflussen Antidepressiva die Konzentration bestimmter Neurotransmitter im Gehirn. Bei Venlafaxin, einem Wirkstoff aus der Gruppe der Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, sind dies die Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin. Aufgrund seines Wirkmechanismus, der die Wiederaufnahme sowohl von Serotonin als auch von Noradrenalin hemmt und somit die Konzentration beider Neurotransmitter erhöht, kann Venlafaxin auch Erkrankten helfen, die nicht (ausreichend) auf eine Therapie mit einem selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wie Citalopram, Escitalopram oder Sertralin ansprechen.
Newsletter abonnieren und gewinnen! 
Melden Sie sich für unseren wöchentlichen Newsletter an und nehmen Sie automatisch an der nächsten Verlosung des Preisrätsels teil.