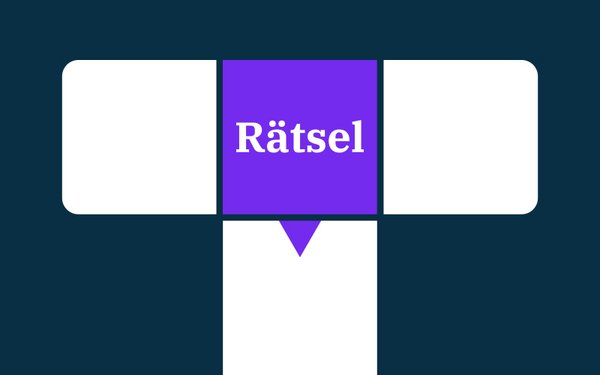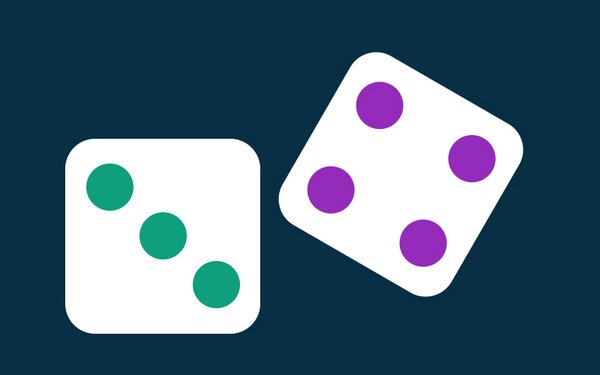reset
Warum das Gehirn vergessen muss

Wer gibt schon gern zu, die Brille verlegt oder einen Termin verschwitzt zu haben? Auch unter Gedächtnisforschern gilt Vergessen als Gegenpol zum Erinnern, falls sie es überhaupt beachten. Dabei ist es weit mehr als nur eine Lücke im Gedächtnis – es ist ein integraler Bestandteil davon, schreibt Neurobiologe Martin Korte in diesem Aufsatz und in seinen Büchern.
Was wir uns merken, erleben oder für die Zukunft planen, hängt nicht nur von unseren vorhandenen Erinnerungen ab, sondern auch von all dem, was wir nicht mehr wissen. Die Situation gleicht einer Marmorskulptur, die gerade erst durch das entfernte Gestein entsteht.
Da unser Leben aus fortlaufenden Veränderungen besteht, ist es ganz entscheidend für unser Gehirn, zu vergessen. Um uns an wandelnde Umweltbedingungen anzupassen, müssen wir sowohl Neues lernen als auch bereits Gelerntes wieder verlernen (also vergessen) sowie umlernen.
Das lässt sich gut anhand der Wahrnehmung verdeutlichen: Wir müssen das, was wir sehen, fühlen, hören, schmecken oder riechen, zwar kurz im Gedächtnis behalten, allerdings nur so lange, bis der nächste Sinneseindruck ankommt.
Weil zum Beispiel die Verarbeitung des Seheindrucks in der Retina länger dauert als die des Schalls im Innenohr, speichern wir jeden Input eines Sinnessystems etwa eine Viertel Sekunde lang, sonst könnten wir eine Stimme nicht der entsprechenden Lippenbewegung zuordnen.
Aber sobald der nächste Sinneseindruck folgt, muss der alte gelöscht werden, damit die beiden sich nicht überlagern. Löschen und Vergessen sind daher keine Fehler oder Aussetzer in der Wahrnehmung, vielmehr gehören sie fest zu den dafür nötigen Abläufen. Längerfristiges Speichern und Erinnern leisten wir uns dagegen nur bei einem verschwindend kleinen Teil unserer Erlebnisse.
Wenn wir etwas Neues abspeichern, ist es häufig sinnvoll, frühere Ereignisse zu überschreiben. So ist es für uns nicht relevant, wo wir das Auto vor einer Woche geparkt haben oder wo es am häufigsten steht. Stattdessen müssen wir uns daran erinnern, an welcher Stelle wir es beim letzten Mal abgestellt haben. Diese Art des fokussierten Vergessens betreiben wir ständig, etwa bei alten Passwörtern.
Auch die bewusste Erinnerung an die ersten Lebensjahre, in denen wir unglaublich viel lernen, vergessen wir im Lauf des Lebens. Ebenso begeben wir uns jede Nacht in eine mehrstündige Phase der Amnesie. Im Schlaf fehlen entscheidende Voraussetzungen zur Gedächtnisbildung: Die Instanzen des Gehirns, die ein Ich-Bewusstsein vermitteln, befinden sich im Ruhezustand.
Dieses Bewusstsein ist aber notwendig, um etwas im autobiografischen Gedächtnis speichern zu können. Ebenso sind jene Neurotransmitter wenig aktiv, die es braucht, um das Gelernte durch eine Stärkung der Kommunikation zwischen Nervenzellen abzuspeichern, etwa Azetylcholin, Dopamin und Noradrenalin.
Was wie ein Fehler erscheint, ist genauer betrachtet jedoch sinnvoll: Um tagsüber Erlebtes zu festigen, soll nichts störendes Neues hinzukommen. So wie man die Augen schliesst, um sich zu konzentrieren, sperrt das Gehirn die Gegenwart im Schlaf aus, um besonders gut speichern zu können. Daher ist Schlaf für die Gedächtnisbildung essenziell.
Das deutsche Wort »vergessen« beruht auf dem Stamm »gessen« und drückte ursprünglich eine Bewegung in Richtung des Sprechers aus; er »bekommt« also etwas. Durch die Vorsilbe »ver« wird es ins Gegenteil verwandelt. Damit ist Vergessen vom Wortstamm her ein aktiver Prozess – entgegen unserem Alltagsverständnis.
Tatsächlich passiert Vergessen im Gehirn ebenfalls nicht passiv, etwa indem lange nicht genutzte synaptische Verbindungen einfach schwächer würden. Stattdessen gleicht es einem gut programmierten Spamfilter, der von Natur aus unserem Gedächtnis innewohnt.
Arbeitet dieser nicht, erdrückt einen die Fülle irrelevanter Informationen regelrecht. Auch abstraktes Denken funktioniert nur, wenn wir Unmengen an Informationen weglassen, ignorieren und vergessen. Einzelnen Gedächtnis-Savants gelingt das nicht.
Diese Menschen sind Berühmtheiten, weil sie etwa jedes Wort eines gelesenen Buchs im Gedächtnis behalten. Aber sie können ihr Wissen nicht dazu verwenden, kreativ Probleme zu lösen oder Neues zu entdecken.
Vergessen erlaubt es dem Gehirn, sich auf die jeweils wesentlichen Informationen zu fokussieren und alle unwichtigen, damit verknüpften Fakten zu unterdrücken, damit bei einem Gespräch keine klangverwandten Wörter abgerufen werden oder irrelevantes Wissen im Bewusstsein auftaucht.
Das macht die Informationsverarbeitung schnell und präzise. Manchmal unterlaufen dem Spamfilter jedoch Fehler, so dass uns Dinge nicht einfallen, die wir gern in einem bestimmten Moment parat hätten. Vergessen ist eben nicht immer sinnvoll und adaptiv, so wie auch Lernen maladaptiv sein kann, etwa wenn Menschen ein Suchtverhalten entwickeln.
Bei so genannten freudschen Versprechern funktioniert der Mechanismus ebenfalls nicht richtig. Anders als gemeinhin angenommen offenbaren sie keine geheimen Wünsche; vielmehr entstehen sie, wenn einem assoziierte, aber unpassende Wörter in den Sinn kommen.
Die molekularen Grundlagen des Erinnerns und Vergessens sind ähnlich
Wie gut wir uns erinnern, hängt also unter anderem davon ab, wie gut wir vergessen. Damit ist Vergessen nicht der Feind des Lernens, sondern sein Verbündeter. Ein ihm zu Grunde liegender zellulärer Mechanismus heisst Langzeitdepression (LTD).
Er findet an den gleichen Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen (den Synapsen) im Hippocampus und in anderen Hirnregionen wie der Amygdala statt, die auch beim Speichern neuer Informationen beteiligt sind – bei der so genannten Langzeitpotenzierung (LTP).
Das ist bemerkenswert, denn der Hippocampus spielt eine wichtige Rolle dabei, Fakten und autobiografische Erinnerungen vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis zu übertragen. Inzwischen können Forscher den Prozess der Langzeitdepression nicht nur beobachten, sondern sogar aktiv auslösen, indem sie Nervenfasern im Hippocampus für eine längere Zeit mit einer niedrigen Frequenz von ein bis fünf Hertz stimulieren oder miteinander kommunizierende Nervenzellen zeitlich versetzt reizen.
Die molekularen Grundlagen von LTD und LTP sind sehr ähnlich: Entscheidend ist die Menge an Kalzium (Ca2+), die in die postsynaptische Zelle gelangt. Während ein starker Einstrom von Ca2+ durch einen speziellen Glutamatrezeptor (den NMDA-Rezeptor) zu LTP führt, führt ein geringer Ca2+-Zufluss zu LTD.
Bei einer hohen Ca2+-Konzentration werden Phosphatgruppen an die entsprechenden synaptischen Rezeptoren angehängt, um diese effektiver zu machen, bei einer niedrigen werden sie wieder entfernt, was gegenläufige Signalkaskaden auslöst. Dadurch kommt es entweder zu einer Verstärkung oder zu einer Abschwächung synaptischer Übertragungsmechanismen.
Kinder haben noch deutlich mehr Synapsen als Erwachsene. Im Lauf der Zeit kristallisiert sich heraus, welche Verknüpfungen relevant sind und welche nicht mehr benötigt werden. Sie werden ausgedünnt, um die Verarbeitung effizienter zu machen.
Je sicherer wir beispielsweise eine Sprache beherrschen, umso weniger Neurone sind beim Sprechen aktiv. Als Erwachsene hören wir bestimmte Laute nicht mehr, die wir als Kleinkinder noch wahrnehmen konnten. So »vergessen« deutsche Muttersprachler etwa, welche Mischlaute zwischen p und b liegen, um beide Buchstaben beim Sprechen und Zuhören schneller unterscheiden zu können. Auch dieser Prozess könnte auf der Langzeitdepression basieren.
Ein Neuron steht mit bis zu 100 000 anderen in Verbindung. Zwischen seinen verschiedenen Synapsen herrscht ein Konkurrenzkampf. Häufig kommunizierende Kontaktstellen verändern sich sowohl strukturell als auch funktionell und ziehen von benachbarten, aber weniger aktiven Synapsen so genannte Wachstumsfaktoren ab.
Das sind körpereigene Proteine, die verschiedene wichtige Funktionen der Nervenzellen wie deren Wachstum und Überleben regulieren. Dieser Mechanismus schwächt weniger benutzte Synapsen und stärkt wiederholt aktive.
Er ermöglicht es, das Anhäufen grosser Mengen unnützer Informationen zu verhindern und kurzfristig Gespeichertes wieder zu löschen. Denn wären alle synaptischen Kontakte eines Neurons durch Langzeitpotenzierung maximal verstärkt, könnte die Zelle nichts Neues mehr abspeichern und wäre zudem leicht übererregbar, was eine Epilepsie auslösen könnte.
Ob wir allerdings tatsächlich vergessen oder ob der Zugang zu einer Erinnerung bloss schwieriger wird, darüber diskutieren Forscher nach wie vor. So könnte es sein, dass das Gehirn beim so genannten Extinktionslernen eine vorher erworbene Assoziation zwischen zwei Ereignissen vollständig durch eine neue überschreibt.
Ebenso wäre es jedoch möglich, dass es etwas, was im Nervensystem fest verankert wurde, nie wirklich löscht. In so einem Fall könnte die Erinnerung wieder auftauchen. Hintergrund dieser Diskussion sind unter anderem Ergebnisse von Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried, die gezeigt haben, dass einmal geknüpfte strukturelle Nervenverbindungen, die mit dem Erinnern einhergehen, dauerhafter bestehen bleiben als funktionelle Veränderungen wie die Langzeitpotenzierung und die Langzeitdepression. Das spricht für die Annahme, dass wir nie wirklich vergessen.
Martin Korte ist Professor für Zelluläre Neurobiologie an der Technischen Universität Braunschweig. Er erforscht seit vielen Jahren die zellulären Mechanismen des Lernens, Erinnerns und Vergessens.
Newsletter abonnieren und gewinnen! 
Melden Sie sich für unseren wöchentlichen Newsletter an und nehmen Sie automatisch an der nächsten Verlosung des Preisrätsels teil.